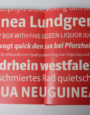Mappenwerk zu Kurt Schwitters im Handsatz
Ein Zitat von Kurt Schwitters besagt, Kunst sei nichts anderes als Gestaltung mit beliebigem Material. So hatten wir, die Studenten des diesjährigen Erstsemesters, die Aufgabe und Ehre, uns nicht nur mit dem herausragenden deutschen Künstler Kurt Schwitters und seinen Thesen zur Typografie, sondern auch mit einem ganz neuen »Material« zu beschäftigen.
Kurt Schwitters gehört schon durch seine Leidenschaft, das »Merzen«, zu den einzigartigsten Künstlern des an sich schon eigenartigen Dada. Das Wort »Merz« leitet Schwitters vom Wort »Kommerz« ab, welches auf einem Zettel geschrieben stand, den er zufällig fand und sollte ein Ausdruck dafür sein, Neues aus alten Scherben aufzubauen. Dies war für den Künstler nicht nur Name oder Kategorie, sondern vielmehr der Ausdruck seines Lebens, denn Schwitters betrachtet sein Leben als Gesamtkunstwerk – Leben und Kunst miteinander vereint, den gesamten Inhalt seines Lebens stellt er mit diesem Begriff dar. Die spielerische Verbindung verschiedenster Dinge wie Zeitungsausschnitte, Busfahrscheine, Nägel, Haare oder Holzstücke machen Schwitters Collagen zu einem gestalterischen Hingucker.
Nach Recherche und intensiver Auseinandersetzung mit diesem Künstler und seinen Thesen ging es auch für uns nun endlich an die Arbeit – hierbei verlief vor allem die Vorbereitung der Entwürfe bei jedem anders. Während die eine sich intensiv mit der Gestaltung Schwitters auseinandersetzte und ganz nach seinem Motto »etwas Neues aus seinem Alten« machte, ging die andere eher spielerisch mit diesem Thema um und befasste sich mit einer rein typografischen Lösung der Thesen. So verschieden die Arbeitsweisen wohl auch gewesen sein mögen, unsere Mappe mit den fertigen Drucken, ergibt insgesamt eine sehr schöne Gesamtheit!
Wir, Julia Floth, Selina Schwander, Eva-Maria Oberauer, Victoria Eckl und Katharina Hengster, möchten uns hiermit auch nochmals recht herzlich bei Herrn Westermaier und Frau Schmitz für ihre Bemühungen und Geduld bedanken – nach dem Erwerb unseres Werkstattführerscheins werden wir uns nun sicher häufiger in der Druckwerkstatt über den Weg laufen!
Fotos: Katharina Hengster, Victoria Eckl, Sybille Schmitz