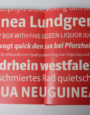Typografie (2. Semester): Silvia Rädermacher
Buchgestaltung: Typografie in der Weimarer Republik (1918–1933), Beitrag 2
Die Idee »mit einer Rundschriftfeder eine Druckschrift« (1903) zu schreiben, veränderte den Werdegang von Rudolf Koch (1876–1934) maßgeblich. Das Leben des gebürtigen Nürnbergers selbst war bis dato von Entbehrungen geprägt: Koch wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, erledigte Gelegenheitsarbeiten im Buchgewerbe, war zwar kunstbeflissen, verfügte jedoch über keine anerkannte Ausbildung. 1906 meldet er sich auf die Anzeige von Karl Klingspor – Leiter der berühmten Gießerei Klingspor in Offenbach, ehemalige Rudhardsche Gießerei –, der das Talent des »erleuchteten Amateurs«* erkennt und ihn über 30 Jahre, bis zu seinem Tod im Jahr 1934 beschäftigt.
Koch mag für heutige Augen stark polarisieren – faszinierend in Schreibkunst und Schriftschaffen und zugleich irritierend, bezogen auf die aus dem ersten Weltkrieg resultierende, fast fanatische Religiosität. Kochs enorm ausdrucksstarke Schriftarbeiten und Kalligrafien hatten meist religiösen Inhalt; sie waren ihm selbst »Gottesdienst«**.
Sein enormer künstlerischer Beitrag besteht in der Weiterentwicklung der Fraktur, der er neue Strenge und Würde verleiht. Koch selbst gilt als »Meister der geschriebenen Schrift«, die meisten seiner bei Klingspor erschienen Schriften wurden »aus dem Vorgang des Schreibens« entwickelt. Zu nennen wären hier etwa Kabel, Koch Antiqua, Maximillian Gotisch, Wilhelm Klingspor Schrift, Neuland, Peter Jessen Schrift, etc.
Silvia Rädermacher hat ihr Büchlein dem Lebenswerk dieses eigenwilligen Meisters gewidmet. Ihr Buch selbst ist dabei spielerisch komponiert, enthält alle Fakten zum Œuvre und Werdegang. Das Werk Kochs im Anhang ist in würdevoller Strenge präsentiert. Sehenswert!
Fotos: Marina Scalese
* Bertram, Axel: Das Wohltemperierte Alphabet. Eine Kulturgeschichte, Leipzig, 2004, S.108
** ebenda.