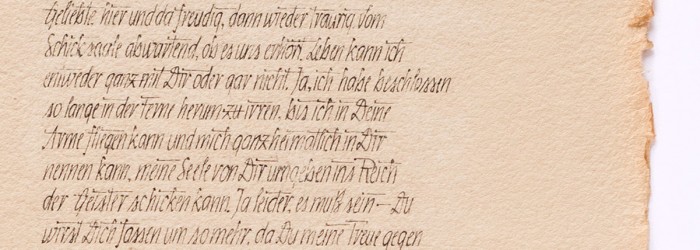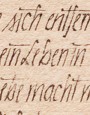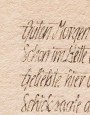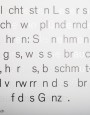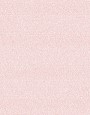Experimentelle Typografie
Der Köter
»Laut und Leise, Laut und Leise … Tja, was könnte ich da nur machen? Laut und Leise … Dieser blöde Köter vom Nachbarn, das kann’s doch nicht geben, kann der mal still sein? Den ganzen Tag bellt der. Furchtbar. Fenster zu. Laut und Leise. Echt schwierig das Thema! Huch!? Susi, wo kommst du denn her? Springst hier einfach auf den Laptop und willst gestreichelt werden? Ich kann jetzt nicht, ich muss was für die Uni machen. Laut und Leise. Laut und Leise. Ich schrei auch gleich mal ne halbe Stunde los, dann weiß der Köter auch mal, was laut ist! Laut.. Laut?«
So in etwa ist es mir gegangen, als ich mir Gedanken zur Aufgabenstellung »Laut und Leise« gemacht habe. Tagtäglich bellt der Nachbars-Hund, so dass man sich auf überhaupt nix mehr konzentrieren kann. Also für mich gibt es nichts lauteres als diesen Köter. Als Besitzerin von drei kleinen Mietzekatzen kenn ich mich dafür aber auch mit dem Leise-Sein aus. Weil die drei schaffen’s immer wieder, mich zu erschrecken, wenn sie ganz ganz leise auf ihren Samtpfoten hereingeschlichen kommen und plötzlich auf meinen Schreibtisch springen, weil sie natürlich jetzt sofort meine volle Aufmerksamkeit brauchen. Böse kann ich denen aber im Gegensatz zum Köter natürlich nicht sein.
Und eines habe ich daraus sogar noch gelernt, die beste Inspiration ist oft ganz nah. Zum Beispiel beim Nachbarn. Oder schnurrend auf dem Schreibtisch.