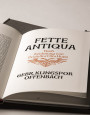Schriftanalyse 2. Semester: Philipp Elsner, Emily Henderson, Tatjana Burka
Kabel, Klingspor, Koch
Für unser Typografie Projekt »Schriftanalyse« fiel die Wahl auf die seriefenlose Schrift »Kabel« von Rudolf Koch. Im Laufe unserer Recherche fiel uns auf, wie umfangreich das Material rund um Rudolf Koch und seine Schriften ist. Seine Arbeit führte er im Umfeld vieler anderer Künstler, Handwerker und Schriftentwerfer in der Schriftgießerei Klingspor aus.
Wir hatten nun also drei wesentliche Gebiete, die erwähnenswert sind: Die Schriftgießerei Klingspor mit all ihren Künstlern, der Künstler Koch im Speziellen, und seine Schrift Kabel. So fiel unsere Entscheidung für jedes Thema ein Buch zu verfassen – KKK.
Im ersten Buch, das sich mit der Schriftgießerei Klingspor befasst, wird ein Blick auf die damalige Zeit geworfen, mit all ihren Revolutionen, Evolutionen und Bewegungen. Die vielen Künstler wie Eckmann, Behrens und Tiemann werden biographisch vorgestellt und ihre Schriften mit großen Abbildungen präsentiert.
Im zweiten Buch unserer Serie wird Rudolf Koch vorgestellt. Sein Leben, seine Karriere, seine Werke, seine Werkstatt und die ewige Suche nach seiner Bibelschrift. Rudolf Koch, der Schreiber, der Mann, der hinter der Kabel steht. Koch hat in seinem Werdegang zahlreiche Schriften erschaffen, unteranderem »deutsche Schrift«, »die Frühling« und »die Karl Klingspor Schrift«. Das Besondere an seinen Schriften ist, das er sie aus seiner eigenen Handschrift und mit der Feder entwickelt hat. Seine Schriften und Werke sind sehr ausdrucksstark und voller Leben. Den Schmerz und die Lebenserfahrungen, die er im Krieg erlebt hat, wurden in seinen Werken zum Ausdruck gebracht und auch sein starker Glaube an Gott beeinflusste seine Arbeit sehr.
Das dritte K steht im Zeichen der Grotesk. Die Schriftanalyse der »Kabel« von Rudolf Koch geht über den geschichtlichen Hintergrund der serifenlosen Schrift über die Analyse der einzelnen Zeichen und ihr Verhalten im Mengentext zu Varianten und Anwendungsbeispielen.