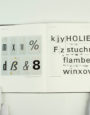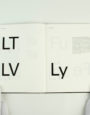Printprojekt (3. Semester): Sakuya Miesczalok
Depression ist medizinisch betrachtet ein sehr komplizierter Zustand, der noch nicht vollständig verstanden ist. Aus der Biologie wissen wir, dass chemische Reaktionen in unserem Körper einen großen Einfluss auf unseren seelischen Zustand haben und gewisse Ungleichgewichte zu ernsten Gefühlsschwankungen führen können. Diese beeinflussen dann unser tägliches Leben. Jeder hatte schon »depressive Phasen« und kennt den Zustand intensiver Traurigkeit. Allerdings leidet nicht jeder der »depressive Phasen« hatte auch an »Depression«. Hier liegt oft ein Missverständnis, das ich für ein ernstzunehmendes Problem halte. Viele glauben fälschlicherweise aus extremer Traurigkeit eine Diagnose von Depression ableiten zu können. Die Unterscheidung zwischen »traurig« und »nicht traurig« greift für eine Diagnose von Depression allerdings zu kurz.
Mein Ziel ist es mit dem hier vorgelegten Poesiebüchlein ein abstrakteres Verständnis dieser Krankheit aufzuzeigen. Dies soll helfen Menschen vom Stigma der Depression zu befreien und nicht einfach »Traurigkeit« verbildlichen. Ich habe einige medizinische Expertenmeinungen zur Krankheit und verschiedene Theorien zur möglichen Heilung herausgesucht, vor allem um den Leser daran zu erinnern, dass Depression keine gewöhnliche Krankheit ist. Opfer erleben jeden Tag die Schwierigkeit erklären zu müssen, was mit ihnen geschieht und schaffen es nicht ihren Zustand präzise zu beschreiben. Ich will mit diesem Heft außerdem zum Verständnis beitragen, dass das Studium der gängigen Literatur zum Thema nur ein Aspekt ist um einem Betroffenen zu helfen und dass Zuhören eine ebenso wichtige Rolle spielt. Mit meiner typografischen Arbeit versuche ich, dieser Komplexität Ausdruck zu verleihen.
Fotos: Sakuya Miesczalok