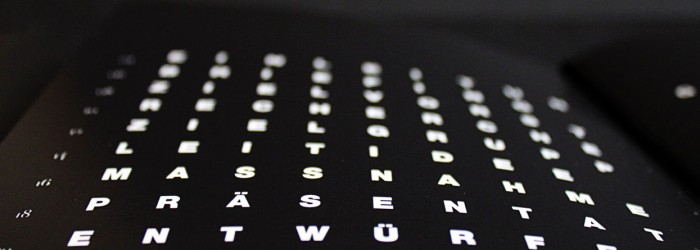Schriftanalyse der Caslon 540
John Haag, Jochanan Hermann, Manuel Schäfer, Florian Schmidt und Stefan Stork
Die Schriftfamilie Caslon ist eine der wichtigsten Vertreter der Barock Antiqua. Sie gilt als Einleitung der englischen Schriftgeschichte, da vor William Caslons Wirken in England Schriften hauptsächlich importiert und kopiert wurden. Weil in England die meisten verwendeten Schriften aus niederländischen Schriftgießereien stammten, hat sich auch William Caslon an holländischen Barock-Typen orientiert. Nach der Veröffentlichung der berühmten Einblattschriftprobe von William Caslon im Jahr 1734, wird England erstmalig zum Exporteur von Schriften, und die Caslon zur meistverwendeten Schrift Großbritanniens. Die Caslon wird unter anderem zur Schrift des britischen Königshauses und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.
»Caslon ist nicht gleich Caslon«
Da die Caslon eine alte Barock Antiqua ist, die bis heute erfolgreich verwendet wird, gibt es viele unterschiedliche Schriftschnitte aus den verschiedenen Epochen.
Angefangen mit dem Erfolg im 18. Jahrhundert, der irgendwann durch das Aufkommen neuer Barock-Schriften wie der Baskerville abnimmt, erlebt die Caslon einen weiteren Aufschwung Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen neuer Drucktechniken. Weiterhin entstehen ab 1900 unzählige Versionen der Caslon, auch durch die zunehmende Digitalisierung und der Einfügung von Typografie in elektronische Medien, von denen jedoch der Großteil unbrauchbar ist.
Unsere Schriftanalyse bezieht sich auf eine sehr gelungene Version, der Caslon 540 aus dem Jahr 1902, die von den American Type Founders veröffentlicht wurde.
Dabei gliedert sich das Buch in zwei Teile, die Geschichte und die Analyse. Zunächst wird der Werdegang der Schrift, das Leben von William Caslon und die Geschichte der Schriftgießerei umfassend dargestellt, während im zweiten Teil eine ausführliche Analyse der Einzelzeichen sowie ein Schriftvergleich erfolgt. Verglichen wird dabei die Caslon 540 mit der Adobe Caslon um die teils extremen Unterschiede der Typen innerhalb der Schriftfamilie Caslon darzustellen. Die Caslon ist eine zeitlose und schöne Schrift, die sich für Fließtexte wie auch Auszeichnungen bestens eignet.
Autor: John Haag; Fotos Buch: Veronika Disl, Manuel Schäfer, Florian Schmidt, John Haag, Jochanan Hermann, Stefan Stork