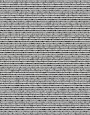Musikvisualisierung zu »Kelly Watch The Stars« von Air
Space-ig abgehoben, sphärenhaft, schillernd glitzernd, technisch kristallin und dennoch wolkig-sanft fließend, leicht und von Raum und Zeit losgelöst. So lässt sich »Kelly Watch The Stars« in Worten ausdrücken. Doch wie kann man die Atmosphäre, Emotionen und Eindrücke in einem Objekt festhalten?
Grundlage des Versuchs einer derartigen Umsetzung bildet dabei die Einteilung der verschiedenen Instrumente bzw. des Gesangs in einzelne Ebenen, welchen aufgrund der Verzerrung durch Synthesizer jeweils unterschiedliche Grade von »Festigkeit« und »Gewicht« zugeordnet werden können. So zeigt sich die Gitarre als unterste Lage in ihrer Klangfarbe noch relativ klar definiert, hart und bodenbehaftet, während eine reine Synthesizerebene diffus, unscharf und wolkig im Hintergrund zu stehen scheint und vom Gesang als Verdichtung inmitten dieser Leichtigkeit durchschwebt wird.
Um die Eigenschaften der Ebenen und den allgemeinen Charakter des Liedes noch mehr zu betonen spielt auch die Wahl des Materials eine wichtige Rolle. »Kelly Watch The Stars« weckt beim Hörer schnell Assoziationen zu einer Reise durch die Unendlichkeit des Weltalls oder die Spähren des Traums, ist leicht, glitzernd, in sich durch den Synthesizer kristallin und doch in der Gesamtheit fließend. Diese Eigenschaften werden durch ein feines Edelstahlgewebe in den den Ebenengewichtungen entsprechenden Farben widergespiegelt. Zusätzlich wird jede der drei Lagen gemäß der Melodien der einzelnen Musikinstrumente gefaltet und im Gesamtobjekt so angeordnet, dass sich eine nach rechts oben aufstrebende und auffächernde Längsstruktur ergibt. Aufgrund der Ähnlichkeit zu einer Art Strahlung oder Falte im Raum in deren Tiefen der Zuhörer sich verlieren kann schließt sich auch hier der Kreis zum Motiv des Alls oder des Traums.
Momentaufnahme
Natalie Kennepohl, Kevin Kremer, Miriam Rieger, Laura Ostermeier
Die Zeit vor dem ersten Weltkrieg war so vielfältig, wie es selten eine Zweite war. Zwischen der Weltausstellung von 1900 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs befand sich Europa im Wandel – der Alltag, die Kunst, Wissenschaft und Politik wurde von unterschiedlichsten Strömungen beeinflusst und durchrüttelt. So postulierte Virginia Woolf mit den Worten »In or around 1913 Human character changed« ein Sinnbild der damaligen Zeit – Frauen kämpften öffentlich und voller Elan für das Wahlrecht, die Kunst befreite sich von gegenständlicher Gebundenheit, die Männlichkeit wurde als solche grundlegend in Frage gestellt und Freud begann, die dunkle Seite der menschlichen Seele zu erforschen.
Um all die Strömungen des Anfangs des 20. Jahrhunderts gebührend widerspiegeln zu können, wurden verschiedensten thematischen Gebieten dieser Zeit innerhalb des Projekts, ein eigenes Buch gewidmet. Als Vorlage für den Inhalt dienten Auszüge aus dem Buch »Der Taumelnde Kontinent« von Philipp Blom, erschienen im Hanser Verlag. In seinem Buch inszeniert Blom den Anfang des 20. Jahrhunderts als spektakuläre Phase der europäischen Geschichte und schafft es die damaligen Geschehnisse ohne die langen Schatten, die die Zukunft auf diese Zeit werfen wird, in Szene zu setzen, als eine Zeit, irgendwo zwischen dem »Fin de Siècle« und der »Belle Epoque«, in der die Menschen einen Weg ins Unbekannte wagten und trotz der Erregung von Unsicherheit geplagt wurden.
Das Projekt besteht aus insgesamt acht Büchern, deren Erscheinungsbild an die zur selben Zeit aufkommenden »Inselbüchlein« erinnern soll – alle Bücher besitzen einen repräsentativen Schutzumschlag im ähnlichen Stil. Im Bleisatz bedruckte Etiketten, die jeweils an identischer Stelle auf den Schutzumschlägen befestigt sind, geben dem Projekt charakterlich eine zusätzliche Verbindung zwischen damals und heute. Ein schlichter, schwarzer Schuber hält das Projekt zusammen und gibt dem Ganzen einen sinnbildlichen Rahmen. Als zusätzliches Gestaltungselement besticht jedes Buch durch eine handwerkliche Besonderheit – entweder ist es das Papier, auf dem gedruckt wurde, kleine handwerkliche Raffinessen bei der Weiterverarbeitung der Bücher, oder der experimentelle Einsatz von verschiedenen Formaten innerhalb eines Buches.
Durch die thematisch unterschiedlichen Schwerpunkte sollen einzelne Zeitzeichen aufgegriffen und dem Leser ein Überblick dieser rasenden Zeit gegeben werden. So greift eines der Bücher eine Vorlesung Sigmund Freuds auf, ein Anderes beschreibt den Glanz der damaligen »Paläste für das Volk«. Auch der Kampf der Frauen um das Wahlrecht, der Einsturz des männlichen Egos und der Rausch der Geschwindigkeit, ermöglicht durch die neue Technik, werden in den Büchern beschrieben. Das Projekt präsentiert einen Anklang an die damalige Zeit und eröffnet dem Betrachter neue Blickwinkel auf eine erregende Zeitspanne.
Almanach einmal anders
Veronika Disl, Natalie Kennepohl, Kevin Kremer, Miriam Rieger, Lars Reiners, Maria-Theresia Steiner
Die Bachelorarbeiten der Absolventen des Fachbereichs Mediadesign werden in einem »dreispurigen« Leporello dargestellt. Dabei wurde das Format so unterteilt, dass jede Arbeit auf einer der drei Papierbahnen, auf drei nebeneinanderliegenden Feldern präsentiert wird. Diese Felder folgen einer klaren Strukturierung. So ist je auf einem Feld das Profilbild des Bacheloranden, ein aussagekräftiges Bild der Arbeit und eine kurze Beschreibung dazu, sowie der Kontakt des Absolventen abgebildet.
Der typographische Reiz liegt dabei in einer rhythmischen Anordnung der Informationen zu den Arbeiten und der Absolventen. So ist der Titel jeder Arbeit in Versalien gesetzt und in einem harmonischen Raumgefüge frei und im Bezug zu dem Fließtext angeordnet. Außerdem sind sowohl Schrift, als auch Bilder ausschließlich in einer Farbe angelegt, wofür bei den Bildern ein einfarbiger Duplex-Modus angewendet wurde.
Die besondere handwerkliche Weiterverarbeitung durch die Falzung und eine ausgeklügelte Falt- und Schneidetechnik ermöglicht es, dass sich die drei Papierbahnen gegeneinander Halt geben und das Leporello aufgestellt werden kann, womit eine neue Dimension der Betrachtungsweise erreicht wird.
Das Konzept, die Gestaltung und Umsetzung stammen von Studenten des Fachbereichs Mediadesign unter der Leitung von Prof. Sybille Schmitz.
Editorial Design (3. Semester)
Stillstand in Bewegung
Lea Roth
Lea Roth hat sich mit dem Futurismus und seinen Darstellungen von Bewegungsabläufen beschäftigt. Wie kommt es zu der dynamischen Sinneserfahrung von Abläufen und dem Bewusstsein von Veränderungen in einem hektischen Tagesverlauf, wo man doch beim Festhalten der einzelnen Momente einem stehenden Bild gewahr wird. In einem Selbstversuch kehrt sie über viele Stunden zur immer gleichen Aufnahmeposition vor ihrem Fotoapparat zurück, um einzelne Momente, die »Gesichtspunkte« in ihrem Zeitablauf festzuhalten. Diese unterschiedlichen Momente werden in diesem Buch zu einem dynamischen Gesamtbild zusammengetragen.
Dieses Buch wird zusammen mit vielen anderen Arbeiten der Klasse MD1012 in der Ausstellung »Zeitzeichen zwischen Stillstand und Bewegung« im Kulturcentrum Puchheim (www.puc-puchheim.de) vom 16. Mai bis 1. Oktober 2014 zu sehen sein. Diese Ausstellung setzt sich anlässlich des 100. Jahrestages des Kriegsbeginns 1914 mit einem für die Zeit bezeichnenden Gegensatz auseinander: Das vor 1914 berühmte Puchheimer Flugfeld wurde nach Kriegsbeginn in ein Gefangenenlager umgewandelt. Dieser Kontrast – die Entwicklung einer neuen Freiheit durch die schnelle, erhabene Bewegung in der Luft und die demoralisierende Erfahrung der Gefangenschaft – war Teil der Aufgabenstellung dieses Studienprojektes.
Musikvisualisierung: 1. Semester
Carolin Ganterer
Visualisierung zu »Kelly watch the Stars«
Carolin Ganterer legt ein kunstvolles Papierobjekt als Metabild für das Lied »Kelly watch the stars« vor. Der Synthie-Pop-Klassiker aus den späten 90er Jahren regt zum Träumen an und dies mit einfachsten Mitteln. Die akribische Kirigamiarbeit, in schlichtem Weiß gehalten, lässt hierbei genug Raum für Assoziationen, visualisiert Klangfolgen, ohne dabei aufdringlich zu werden. Ganz im Sinne der Musiker.
Editorial Design (3. Semester)
»Flucht – Ein Buch über Fluchtmittel, Orientierung, Tarnung, Verstecke, Lücken im System und Ziele«
Corina Garmaier, Corinna Rusker, Lisa Maria Tiefenthaler
Fluchtbewegungen sind mit besonderen Überlegungen hinsichtlich Transportmittel, Wege, Orientierung, Tarnung, Ziele u.a, verbunden. Dies in einer kraftvollen grafischen Sprache spannungsreich zu visualisieren ist den drei Studentinnen mit diesem Buch gelungen. Dieses Fluchtbuch wird zusammen mit vielen anderen Arbeiten der Klasse MD1012 in der Ausstellung »Zeitzeichen zwischen Stillstand und Bewegung« im Kulturcentrum Puchheim (www.puc-puchheim.de) vom 16. Mai bis 1. Oktober 2014 zu sehen sein. Diese Ausstellung setzt sich anlässlich des 100. Jahrestages des Kriegsbeginns 1914 mit einem für die Zeit bezeichnenden Gegensatz auseinander: Das vor 1914 berühmte Puchheimer Flugfeld wurde nach Kriegsbeginn in ein Gefangenenlager umgewandelt. Dieser Kontrast – die Entwicklung einer neuen Freiheit durch die schnelle, erhabene Bewegung in der Luft und die demoralisierende Erfahrung der Gefangenschaft – war Teil der Aufgabenstellung dieses Studienprojektes.
Das Vermächtnis von Lina Haag – Ein dialektisches Ausstellungskonzept
2013, achtzig Jahre nach dem Beginn der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, schwinden die Zeitzeugen dahin. Mit ihrem Schwinden, hat sich die Erinnerungskultur der Deutschen stark gewandelt. Die Stimmen der Opfer des Regimes werden immer leiser. In naher Zukunft werden die jungen Generationen auf die Dokumente und archivierten Zeitzeugnisse angewiesen sein, weshalb es umso bedeutender ist, die existierenden überlieferten, persönlichen Gespräche und Erzählungen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und die Auseinandersetzung mit der schweren Thematik für künftige Generationen möglichst verständlich aufzubereiten. Mit dem Ausstellungskonzept möchte ich die beispiellose Lebensgeschichte einer kommunistischen Widerstandskämpferin greifbar machen, die sich bis zum letzten Atemzug dem Pazifismus, dem Antifaschismus, dem Kampf um Gerechtigkeit verschrieben hat. Es ist die Geschichte meiner Uroma Lina Haag, die 2012 im Alter von 105 Jahren verstorben ist. Nach ihrem elfjährigen Kampf um Freiheit und das Leben ihres Mannes, schrieb sie ihm einen Brief, in dem sie alle Erlebnisse der vergangenen, qualvollen Jahre dokumentierte. Dieser Brief wurde 1947 als einer der ersten Zeitzeugenberichte als Buch, unter dem Titel »Eine Handvoll Staub«, veröffentlicht. Seither wurde es hunderttausendfach gedruckt und ihr Leben zahlreich porträtiert, doch steht dabei meist ihr politisches Wirken und ihr Mut im Fokus. Das Ausstellungskonzept umfasst ihre über hundertjährige Lebensgeschichte als Ganzes. Ihr Leidensweg als politische Kämpferin und ihr lebenslanges Engagement für Gerechtigkeit stehen dabei ebenso im Fokus wie ihr Leben als liebende Ehefrau, Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Anders als bei vielen Werken die sich mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte beschäftigen, soll ihr gesamter Lebensweg im Kontext wahrgenommen werden und dem Betrachter auf eine bewusst distanzierte Art angeboten werden, tiefer einzutauchen, nachzufühlen und zu verstehen.
Kevin Kremer und Miriam Rieger
Facharbeit Fotographie
Bei der entwickelten Bilderserie soll die Gegensätzlichkeit von dem äußerlich wahrgenommenem Individuum und den unbewussten, inneren Vorgängen dargestellt werden. Forschungen aus der Tiefenpsychologie u.a. von Sigmund Freuds Strukturtheorie von Ich, Es und Über-Ich waren hierbei richtungsgebend.
Die Kompositionen, die sich auf das äußere Erscheinungsbild fixieren, sind dabei in einem verstärkten Schwarz-weiß-Kontrast dargestellt. Denn gerade das was einen Menschen wirklich beschäftigt, ist innerhalb einer von Regeln und Normen geprägten Gesellschaft kaum wahrzunehmen.
So verschwindet das Unbewusste hinter einer, sinnbildlich gesprochenen, farblosen Wand. Gerade dadurch soll eine Konzentration auf die abgebildete Person geschaffen werden und eine Gegenspannung zu den inneren Vorgängen erzeugt werden. Diese sind so viel komplexer und kontrastreicher, als es erahnen lässt. Symbolisiert wird das dynamische Unbewusste, von aufeinander prallenden Farbwolken, die sowohl von Trieben verschiedener Art, als auch von Konfliktsituationen zwischen den drei Instanzen der Strukturtheorie bestimmt werden. Nachdem die Prozesse meist so verlaufen, dass das Individuum sich jener gar nicht bewusst ist, soll dies auch in der Bildkomposition ein grundlegender Bestandteil sein.