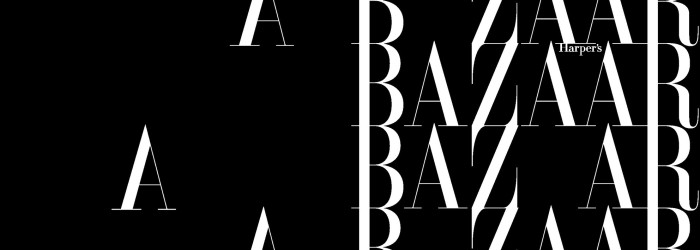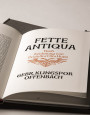Zu Besuch in der Galerie Handwerk (München) und Vorstellung der offizin albis in Garching.
Am 10. November unternahmen wir mit den Grundlagenkursen Typografie eine Exkursion zur Münchner Galerie Handwerk. Die Ausstellung »Handpressen oder die Kunst handwerklicher Buchgestaltung (vom 23. Oktober bis 21. November 2015)« war seit langer Zeit in Fachkreisen erwartet gewesen. Dass in Zeiten der übertechnisierten Machbarkeit gerade handwerklich gefertigte Bücher, die typografisch sauber und kunstvoll durchgestaltet sind, begeistern, darf und sollte nicht verwundern. Der Bleisatz, die mit ihm verbundene Haptik, klassisch künstlerische Druckverfahren sowie elegante, dem Inhalt sinnstiftende Papiere vermögen es, dem Inhalt adäquat Leben einzuhauchen – eben zum passenden Umfeld zu verhelfen.
Die Handwerkskammer fokussierte deshalb hauptsächlich aktuelle Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum. So gab es etwa Pressen- und Mischdrucke von Oskar Bernhard, Anja Harms und Eberhard Müller-Fries, der Goldenen Kanne, der officin albis, der Offizin Haag-Drugulin, der bekannten Münchner Handsatzwerksatt Fliegenkopf, von Mechthild Lobisch, Sabine Golde und Johannes Strugalla, etc. zu sehen. Zudem waren einige historische Beispiele der Buchkunst wie die der englischen Pressen zu begutachten: Doves Press und Kelmscott Press, sowie die bis 1934 tätige Bremer Presse.
Druck und Satz
Unser Termin in der Galerie Handwerk war zudem begleitet von zwei weiteren besonderen Ereignissen: einer Vorstellung der eigenen Bücher durch Werner Hiebel (officin albis) und dem angekündigten Drucken mit einer historischen Presse.
Frau Mücke, Schriftsetzerin, extra aus Dresden (Haag-Drugulin) angereist, erklärte detailliert und geduldig die Funktionsweise der historischen Kniehebelpresse und der mitgebrachten Boston-Presse. Auch leistete Sie einigen Interessierten Hilfestellung bei ersten Handsatzversuchen.
officin albis
Der zweite spannende Programmpunkt: Der leidenschaftliche Typograf Werner Hiebel erklärt der Studiengruppe seine Arbeiten. Extra für diese hat er unter anderem seine »Linie 8«, den »MaskenBall der Tiere« und die »Gerhard Rühm Bücher«, auch in produktionsbedingten Zwischenstadien, mitgebracht. Er selbst hat vor 25 Jahren seine »officin albis« gegründet. Die in Garching ansässige »Ein-Mann-Typografieschmiede« verfügt mittlerweile über ein ansehnliches Repertoire an kunstvoll gestalteten Büchern, Plakaten und Karten. »Kunsthandwerk«, so Werner Hiebel, »möchte er aber eigentlich nicht machen«. Seine Bücher seien vielmehr Kunst und Handwerk zugleich. Ein gutes Buch werde immer von innen nach außen gestaltet. Die Gestaltungskonzeption nimmt Bezug auf den Inhalt, keine effekthascherische Grafik. Er bestimmt die Schrift, die Grundstruktur, das Papier, die Farben und Illustrationen. Auch sollte ein Buch vom Anfang bis zum Ende geplant werden. Dies bezieht auch die Anschaffung des für die gesamte Auflage notwendigen Papieres mit ein. Nachlieferungen seien oft schwierig, da ja der Herstellungsprozess mitunter länger dauere, die Sorte im schlimmsten Fall nicht mehr verfügbar sei.
Von Rosenkränzen und Grundformen
So zeichnet sich das Buch »Rosenkränze« des Autors Gerhard Rühm durch den sinnbildlichen roten Faden aus. Dieser durch die Finger gleitende Faden, grafische Metapher zum katholischen Rosenkranz, führt als gestalterische Linie durch das ganze Buch. Die Werke von Gerhard Rühm zählen zur konkreten Poesie, müssten genau genommen auch laut gelesen werden, und so stehen etwa alle Vokale rot gedruckt untereinander.
Sein »calendarium« arbeitet mit den Grundformen des Design. Ein Holzschnitt aus Dreieck, Quadrat und Kreis entwickelt sich über »zwölf Monate« hinweg zur Gesamtform. Produktionstechnisch wird hier mit sog. Formschwund gearbeitet: Die Gesamtform wird Monat für Monat um ein Segment reduziert. Der Titel, eine Heißfolienprägung, wurde aus einer extra gefertigten Futura Buch gesetzt, die Innentexte in akkuratem Flattersatz.
Endlose Bücher und eine literarische Reihe
Die Leporellos »MaskenBall der Tiere« und »Linie 8« zeigen eine gelungene Verbindung aus Typografie und künstlerischer Illustration. Besonders hervorzuheben ist der Bogendruck des Umschlages, der als lange Gesamtform gesetzt, jeweils im Gesamten in der Maschine gedruckt wurde. Im Handsatz gar nicht einfach. Besonders erwähnenswert erscheint mir auch die komplett aus Satzmaterial gefertigte Straßenbahn des Titels. Das Buch »Banane, Katze, Kakadu« spielt gekonnt mit der Verbindung aus Schriftgraden und Schriftarten.
Die officin albis fertigt zudem seit ein paar Jahren eine kleine literarische Reihe im Buchdruck. Unbekannteren zeitgenössischen Autoren, Künstlern und Illustratoren soll die Chance zu einer ersten Veröffentlichung gegeben werden. Auch soll die Sammelfreude der Leser durch erschwingliche Preise geweckt werden. Die Reihe verbindet die typografische Gestaltung des Umbandes und das gleiche Papier. Auch das Maß der Reihe spiegelt sich bereits im Titel.
Die kleinen Bände sind alle für sich genommen typografische Kleinode, die beispielsweise den Texten von Philipp Luidl und Dagmar Nick das passende Umfeld geben.
Was eigentlich alles hinter der Fertigung eines künstlerischen Buches steht, mag einigen Studierenden hier zum ersten Mal richtig bewusst geworden sein. Begeistert durch die Vorstellung seiner Arbeiten in der Handwerkskammer habe ich bald darauf Herrn Hiebel in seiner Garchinger Werkstatt, vor den Toren Münchens, nochmals besucht. Es war auch diesmal ein bereichernder und inspirierender Besuch, den ich allen Typografie- und Buchfreunden empfehlen kann.