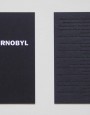Schriftanalyse der Guardian
Paul Kistner, Tatjana Medvedev, Phanpadit Pangnanouvong, Silvan Wenig
Die britische Zeitung »The Guardian« durchlief in ihrer fast 200-jährigen Geschichte viele verschiedene Designs, bis hin zum aktuellsten Redesign aus dem Jahre 2005. Im Zuge dieser Neuauflage wurde zusammen mit vielen anderen Veränderungen, wie etwa dem Wechsel auf das Berliner Format, ein neuer Schriftsatz für die Zeitung entworfen.
Die Schriftentwerfer Paul Barnes und Christian Schwartz befassten sich über mehrere Jahre hinweg mit Versuchen und verschiedensten Stilrichtungen einer passenden Schrift, um das optimale Ergebnis zu erzielen. So entstand ein Schriftsatz, der neben der namensgebenden Egyptienne auch Serifenlose in den verschiedensten Schnitten enthält, um jeder Anforderung gerecht zu werden.
In unserer Schriftanalyse behandeln wir neben der Geschichte der Zeitung auch die Geschichte der Egyptienne-Schriften im allgemeinen und natürlich die unserer Schrift. Hinzu kommen Untersuchungen der einzelnen Buchstaben bis hin zu Vergleichen mit den Schriften Clarendon und der Neuen Helvetica, aus welcher ein Teil des Schriftsatzes der Guardian entwickelt wurde.
Um diese Analyse in einen passenden Rahmen zu bringen, haben wir uns als Format auf die tatsächliche Größe des Guardian, das Berliner Format, festgelegt. Zusammen mit einem ungebleichten Papier in einer Stärke von nur rund 90 g/m2 entsteht so der zusätzliche haptische Eindruck, man würde eine Zeitung lesen. Zusammen mit einem experimentellen Layout entstand so eine Arbeit, die uns einerseits aufgrund der besonderen Geschichte des Guardian, andererseits aufgrund des weiteren Inhalts und Erscheinungsbildes ein wenig mit Stolz erfüllt.