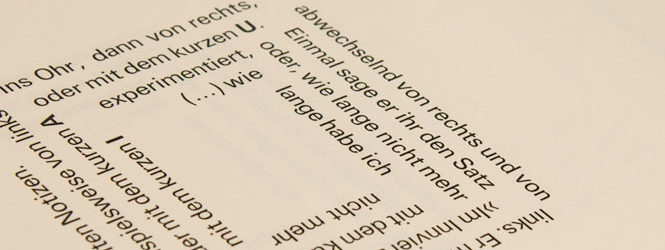Typografische Textstudien und Satzexperimente
zu Thomas Bernhard: Das Kalkwerk (1970)
Im Kurs Bleisatz 1 entsteht derzeit ein Mappenwerk – also eine lose Blattsammlung –zu Thomas Bernhards Roman »Das Kalkwerk«, genauer gesagt zu einem kurzen Auszug daraus [Thomas Bernhard: Das Kalkwerk (1970), Suhrkamp, Seite 73].
Bernhards Schreibstil ist durchweg anspruchsvoll, geprägt von wahnhaft-fiebrigen Monologen, schier endlosen Sätzen in indirekter Rede, Polemik und bernhardscher Boshaftigkeit. Seine Texte handeln stets von menschlichen Abgründen und zersetzen die »katholisch-bürgerliche Moral«. Mit seinem Roman »das Kalkwerk« widmet er sich dem Versuch der Niederschrift einer vermeintlich wissenschaftlichen Studie. Sein Protagonist Konrad dechiffriert die Unerträglichkeiten des Alltags. Dabei nutzt, bzw. mißbraucht er seine an den Rollstuhl gefesselte Frau zu pseudowissenschaftlichen Studien.
[…] wie lange habe ich nicht mehr mit dem kurzen I experimentiert, oder, wie lange nicht mehr mit dem kurzen O, oder mit dem kurzen A oder mit dem kurzen U. Einmal sage er ihr den Satz »Im Innviertel habe ich nichts« beispielsweise von links ins Ohr, dann von rechts, abwechselnd von rechts und von links. Er mache in einer Stunde etwa zwei Seiten Notizen.
Der Text scheint also wie geeignet zu ersten typografischen Satz- und Text-Experimenten im Bleisatz, die vom Druckermeister Günter Westermaier handwerklich und von mir selbst typografisch begleitet werden.
Dabei entwarfen, gestalteten und druckten die Kursteilnehmer Magdalena Stricker, Sakuya Miesczalok, Stephanie Moll, Thomas Fäckl und Josef-Joachim Schuster eigenständig jeweils ein A3 Plakat in dem in der Werkstatt vorhandenen, gut ausgebauten und somit dafür geeigneten Letternmaterial Univers, Trump Mediäval sowie Century. Komplettiert mit Titelblatt und Impressum wird die Mappe wohl diesen Donnerstag fertig sein. Die Studierenden dürften dann einen ersten Einblick in die Herausforderungen des analogen Druckes und Satzes erhalten haben.
Ich freue mich darauf!